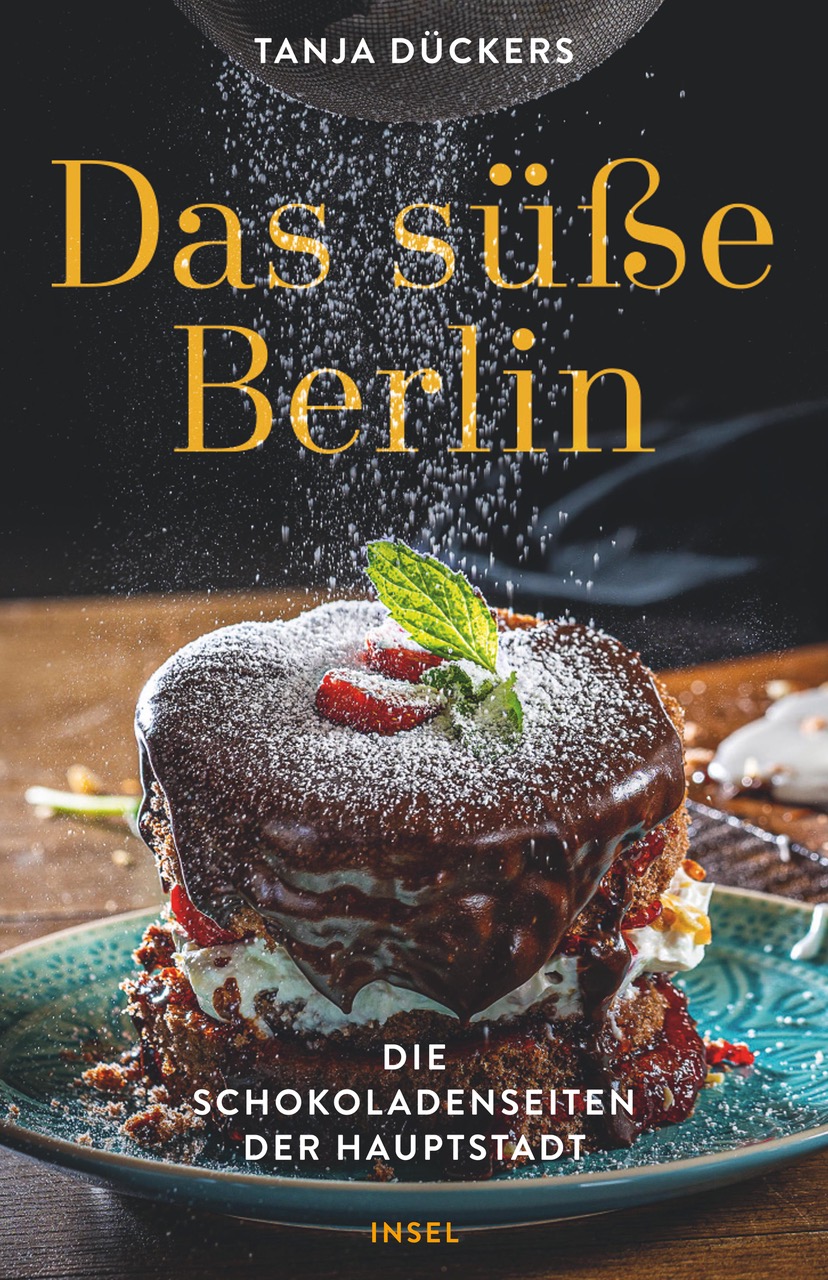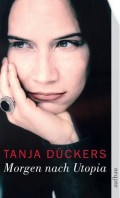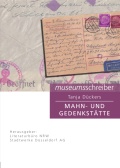Das Leben der Annemarie Böll – Eine Würdigung von Tanja Dückers
Klug, sensibel, unermüdlich: Annemarie Böll war Lebenspartnerin, Erstlektorin und intellektuelle Gefährtin Heinrich Bölls – und selbst eine prägende Stimme der Nachkriegszeit. Das Leben der Annemarie Böll – Eine Würdigung Von Tanja Dückers Herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung kostenfrei, ISBN 978-3-86928-276-3
Das Leben der Annemarie Böll – Eine Würdigung von Tanja Dückers Mehr lesen »